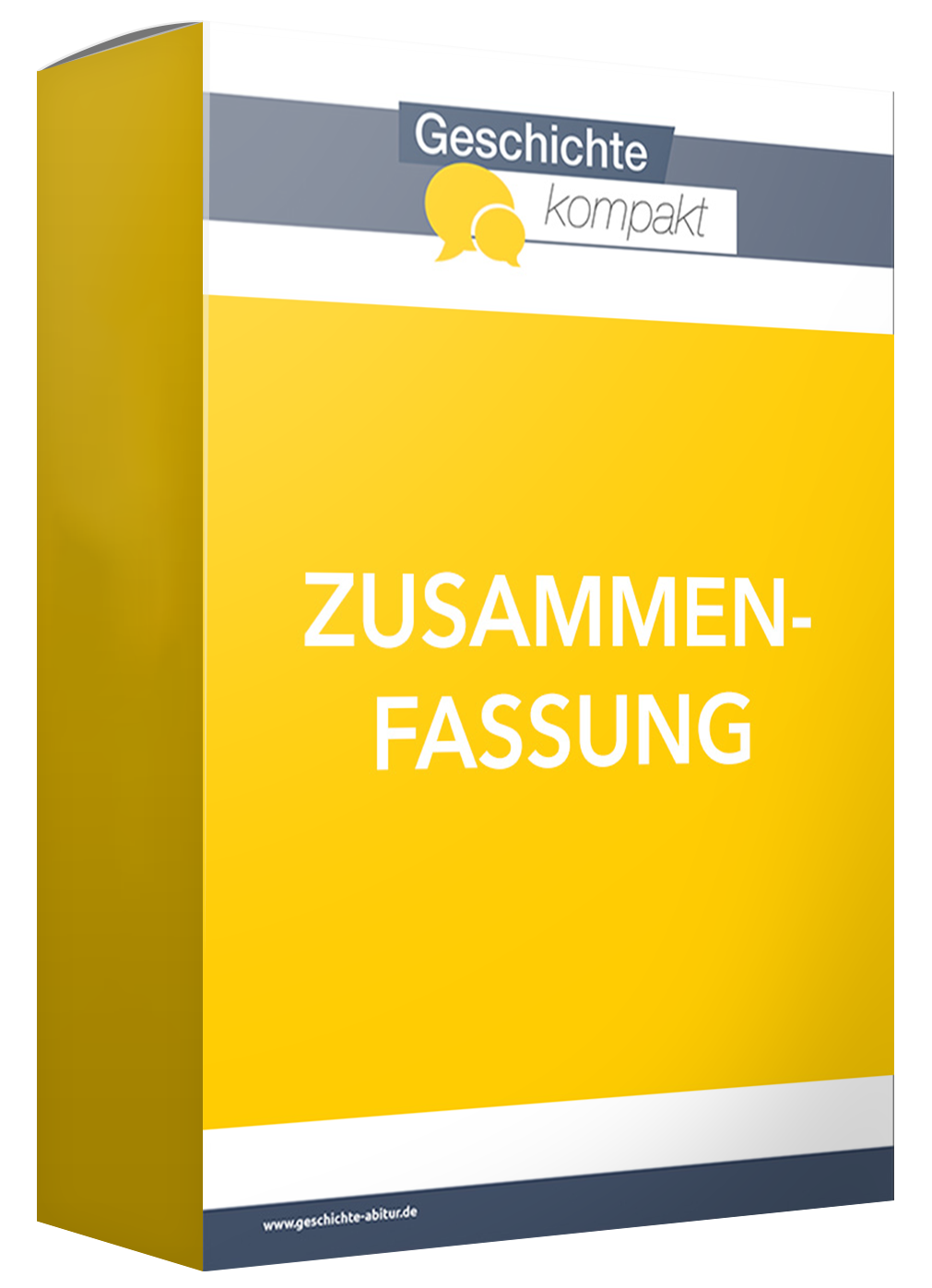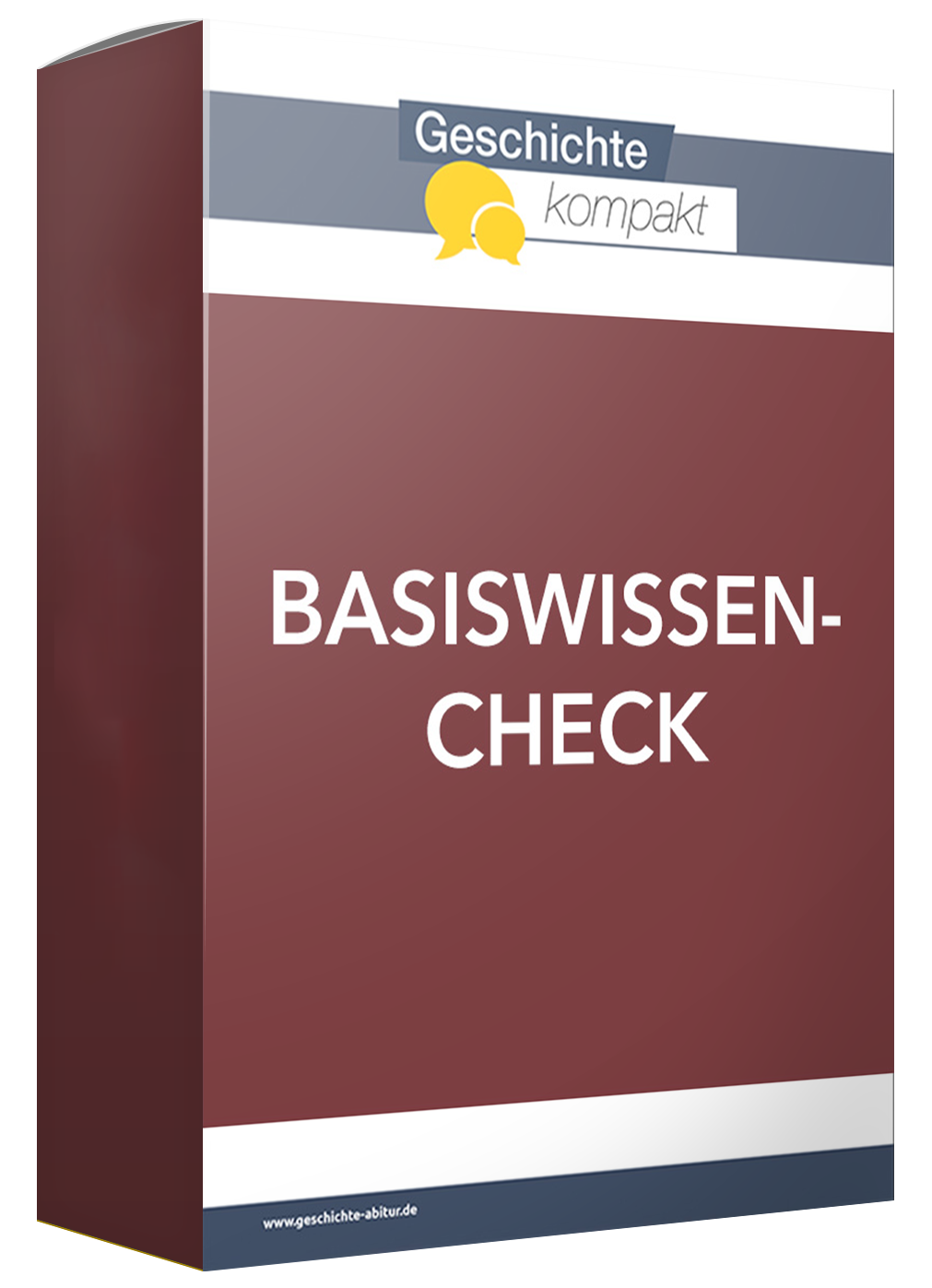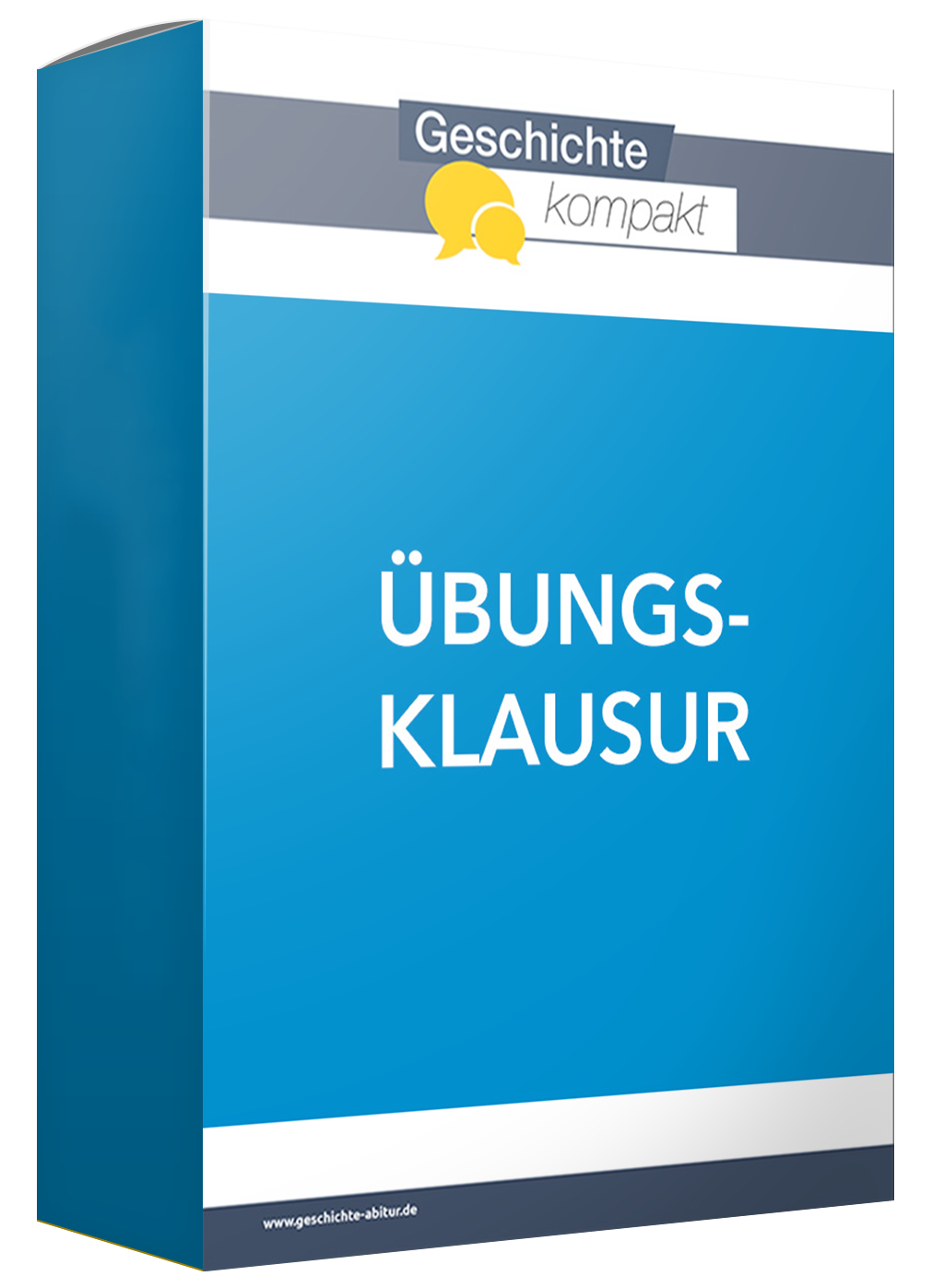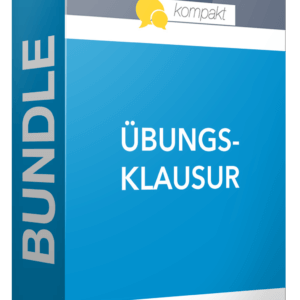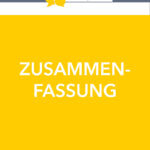Eine Bewerbung ist weit mehr als nur ein Stück Papier oder ein PDF-Anhang. Sie soll Kompetenz vermitteln, Interesse wecken und Persönlichkeit zeigen – und das möglichst auf einer DIN-A4-Seite.
Was wie eine typische Aufgabe der modernen Arbeitswelt erscheint, hat eine lange Entwicklung hinter sich. Bereits im Mittelalter mussten sich Menschen um Positionen bemühen – zunächst meist mündlich, später zunehmend schriftlich. Das Prinzip, sich überzeugend darzustellen, ist also keineswegs neu. Wer sich aktuell mit dem Aufbau und Ton eines Anschreibens schwertut, bewegt sich in guter Gesellschaft – denn vieles, was im Bewerbungsprozess erwartet wird, hat historische Wurzeln, die bis heute nachwirken.

Moderne Bewerbungen bauen auf jahrhundertealten Traditionen auf! (link)
Warum früher Beziehungen wichtiger waren als Bewerbungsunterlagen
Im Mittelalter war der Zugang zu einem Beruf fast ausschließlich durch soziale Netzwerke geregelt. Wer einen angesehenen Lehrer, Meister oder Verwandten kannte, kam leichter an eine Stelle. Mündliche Empfehlungen galten als wertvoller als jede persönliche Darstellung. Leumundszeugnisse – also schriftliche Bürgen für Charakter und Fähigkeiten – gelten als Vorläufer des heutigen Empfehlungsschreibens.
Auch kirchliche Ämter oder universitäre Positionen wurden oft über persönliche Fürsprachen vermittelt. Schriftlichkeit spielte dabei nur eine Rolle, wenn sie dem sozialen Status oder der Machtdemonstration diente. Der „Bewerber“ trat selten selbst in Erscheinung – meist sprach jemand für ihn. Gegenwärtig hingegen gelingt eine selbstbewusste Präsentation deutlich leichter – insbesondere, wenn Bewerbungsvorlagen von CVMaker zu Hilfe genommen werden, um Aufbau, Struktur und Sprache eines Anschreibens gezielt zu gestalten.
Vom höfischen Ton zur strukturierten Selbstdarstellung
In der Frühen Neuzeit wurde schriftliche Kommunikation zunehmend wichtiger. Wer sich an einen Fürstenhof oder eine Universität wandte, tat dies mit elaborierten, oft übertrieben höflichen Schreiben. Die Sprache war blumig, unterwürfig und formelhaft. Vieles davon klingt auch heute noch an, wenn im Anschreiben Redewendungen wie „mit großem Interesse“ oder „hiermit bewerbe ich mich“ auftauchen.
Die Struktur damaliger Schreiben ähnelt bereits dem modernen Anschreiben: Ein Einstieg mit Anrede und Bezug, ein Mittelteil mit Begründung und ein Abschluss mit Wunschformulierung – oft inklusive der höflichen Bitte um Rückmeldung.
Industrialisierung – der Anfang der modernen Bewerbung
Mit der industriellen Revolution veränderte sich der Arbeitsmarkt grundlegend. Erstmals entstanden zahlreiche formelle Arbeitsverhältnisse jenseits von Adel, Kirche und Zünften. In Fabriken, Verwaltungen und Behörden wurde nun systematisch nach Arbeitskräften gesucht – und damit auch nach nachvollziehbaren Bewerbungsverfahren.
Schriftliche Bewerbungen mit strukturiertem Aufbau wurden zur Regel. Schulbildung, Ausbildung und Dienstzeiten mussten klar dokumentiert sein. In dieser Zeit entstanden auch der Lebenslauf im heutigen Sinne und das Bewerbungsfoto – natürlich noch in schwarz-weiß. Das Anschreiben wurde persönlicher, blieb aber weiterhin sachlich. Viele dieser Elemente bestehen noch immer – oft in nur leicht veränderter Form.
Standardisierung in der Nachkriegszeit
Nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmten Bürokratie und Effizienzdenken zunehmend den Bewerbungsprozess. Schriftliche Unterlagen mussten klar, korrekt und formal einheitlich sein. Handschrift war zunächst Standard – sie galt als Ausdruck von Ordnung und Disziplin. Erst später ersetzte die Schreibmaschine das persönliche Schriftbild durch sachliche Typografie.
Das Anschreiben diente vorrangig der strukturierten Selbstdarstellung: Wer bin ich, was kann ich, und warum passe ich zur Stelle? Persönliche Nuancen waren selten, stattdessen dominierten nüchterne Formulierungen und klare Strukturen. Ziel war ein reibungsloser Ablauf – und ein möglichst normgerechter erster Eindruck. Bis heute lassen sich bestimmte Anforderungen, die aus dieser Zeit stammen, erkennen.
Das digitale Anschreiben – alt im neuen Gewand
Mit der Digitalisierung kamen E-Mail-Bewerbungen, Bewerberportale und PDF-Anhänge – doch das Anschreiben überdauerte die Veränderungen. Die Textmenge schrumpfte, die Höflichkeitsform blieb. Nach wie vor gilt: Wer überzeugen will, sollte sich strukturiert, klar und wertschätzend ausdrücken.
Was sich verändert hat, ist die mediale Umgebung. In unserer Zeit wird häufig nach Schlüsselwörtern gescannt, und digitale Tools wie Lebenslaufgeneratoren helfen beim Layout. Dennoch steckt in jeder gelungenen Bewerbung auch ein Stück rhetorische Kulturgeschichte.
Formale Elemente, die geblieben sind
Auch wenn sich Bewerbungsformate im Laufe der Jahrzehnte verändert haben, halten sich einige Strukturelemente bis heute hartnäckig – Überbleibsel einer Zeit, in der Ordnung, Übersichtlichkeit und formalisierte Kommunikation als besonders wichtig galten. Viele dieser Vorgaben stammen aus der Nachkriegszeit und prägen moderne Anschreiben bis in die Gegenwart – oft ganz selbstverständlich.
- klarer Aufbau: Einleitung, Hauptteil, Schluss
- höflicher Ton mit formalen Anreden
- Bezug auf Stellenanzeige oder Motivation
- Hinweis auf Anlagen (Lebenslauf, Zeugnisse)
- Bitte um Rückmeldung beziehungsweise Gesprächseinladung
- Datum und Ort als formaler Bestandteil
- Unterschrift – handschriftlich oder eingescannt, als Zeichen der Verbindlichkeit
Redewendungen, die überdauern
Ein Blick auf aktuelle Bewerbungsschreiben zeigt: Viele Textbausteine haben sich kaum verändert – teils seit Jahrzehnten. Das liegt nicht nur an Tradition oder Bequemlichkeit, sondern vor allem an der sozialen Funktion des Anschreibens. Es dient dazu, Respekt auszudrücken, Orientierung zu geben und die eigene Kommunikationsfähigkeit unter Beweis zu stellen – Erwartungen, die bis heute Gültigkeit besitzen.
Trotz Digitalisierung und moderner Karrieretools wirkt das Anschreiben sprachlich oft erstaunlich traditionsbewusst. Viele Formulierungen stammen aus früheren Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten – sie werden weiterverwendet, weil sie Konventionen bedienen und als seriös gelten. Einige dieser sprachlichen Muster sind längst zu festen Bestandteilen geworden, selbst wenn sie aus heutiger Sicht etwas antiquiert erscheinen.
- „Sehr geehrte Damen und Herren“ – die formale Anredeformel seit dem 19. Jahrhundert
- „Ich bewerbe mich um die ausgeschriebene Stelle …“ – klassischer Einstieg seit der Nachkriegszeit
- „Mit freundlichen Grüßen“ – Grußformel mit bürgerlichem Hintergrund aus dem 19. Jahrhundert
- „Hiermit sende ich Ihnen meine Bewerbungsunterlagen“ – Verwaltungsjargon mit Wurzeln im Amtsdeutsch
- „Ich würde mich über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch freuen“ – höfliche Standardformulierung seit den 1950er-Jahren
- „Mit großem Interesse habe ich gelesen …“ – stammt aus dem Stil höfischer Unterwerfungsrhetorik
Die Zukunft der Bewerbung
Zunehmend treten neue Formen in den Vordergrund: Videobewerbungen, Bewerbungs-Chats, One-Klick-Prozesse auf Plattformen. Auch Künstliche Intelligenz spielt mittlerweile eine Rolle – etwa beim Vorsortieren von Lebensläufen oder der Analyse von Formulierungen.
Trotzdem bleibt das Anschreiben bestehen – weil es mehr ist als ein Informationsträger. Es zeigt Haltung, Ausdruck und Persönlichkeit. Und genau das könnte in einer automatisierten Zukunft entscheidender sein denn je.
Fazit
Moderne Bewerbungen tragen Spuren ihrer Geschichte. Vom Leumund über höfische Anschreiben bis hin zum digitalen PDF – vieles hat sich verändert, aber einiges ist erstaunlich konstant geblieben.
Wer sich mit der Geschichte von Bewerbungsformen beschäftigt, erkennt Strukturen, Sprachmuster und Erwartungen, die über Jahrhunderte gewachsen sind. Und schreibt im besten Fall ein Anschreiben, das nicht nur formal passt – sondern auch kulturell verstanden wird.